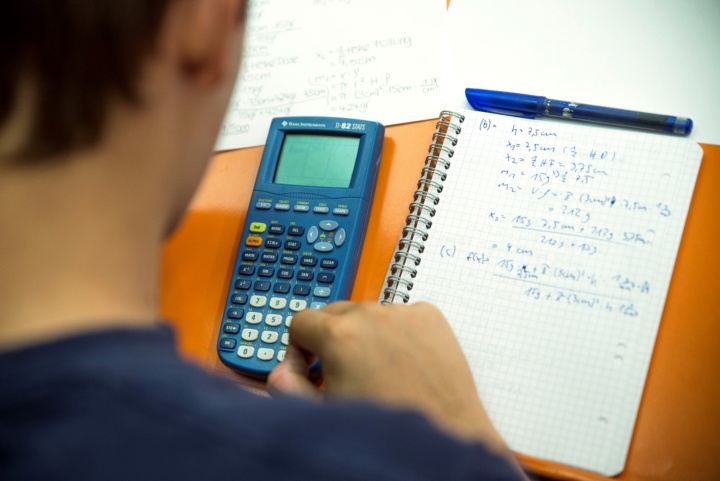Passt Berufspädagogik zu mir?
Meine Fähigkeiten
- Sie sind kommunikationsstark und können gut auf andere zugehen?
- Sie haben einen Blick für die Bedürfnisse und Belange anderer und können Ihre Mitmenschen gut einschätzen?
- Sie haben direkt 1000 Ideen im Kopf, wie man ein Referat verständlicher und interessanter gestalten könnte?
- Sie sind mit Mitmenschen gerne im Austausch und beraten sie, wenn es um größere Lebensentscheidungen geht (z.B. Auslandsjahr, Zukunft nach dem Abi)?
- Sie können Inhalte und Wissen so verpacken, dass andere es verstehen?
- Sie suchen gerne nach kreativen Lösungen und versuchen Ihr eigenes Lernen zu optimieren?
- Andere tauschen sich gern mit Ihnen aus und fragen um Rat, da Sie richtig gut zuhören können?
- Sie können längere Fachtexte (z.B. in Deutsch) gut verstehen und zusammenfassen?
Wenn Sie die meisten Punkte mit „Ja.“ beantworten können, bringen Sie wichtige Voraussetzungen für das Studium der Berufspädagogik mit.
Berufspädagogik ausprobieren?
Sie möchten wissen, mit welchen Themen Sie sich im Studium der Berufspädagogik beschäftigen werden?
- Testen Sie, ob Sie bereits Aufgaben aus dem Studium bearbeiten können.
- Prüfen Sie, ob Ihnen die Bearbeitung der Aufgaben Spaß macht.

Meine Interessen
- Wie „funktioniert“ Lernen?
- Was sind wichtige Qualifikationen in der Arbeitswelt von morgen? Wie können diese gefördert werden?
- Was beeinflusst die Qualität unseres Lernens? Mit welchen Methoden lässt sich ein bestimmtes Lernziel besonders gut erreichen?
- Inwiefern ist Lernen auch immer ein individueller Prozess?
Wenn Sie diese und ähnliche Fragen interessieren, sollten Sie über ein Studium der Berufspädagogik nachdenken.
Berufspädagog*innen beschäftigen sich mit Themen der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Sie konzipieren und organisieren Prozesse, die der Weiter- oder Ausbildung von Mitarbeitenden dienen, z.B. besondere Programme für die Auszubildenden eines Unternehmens, um diese Schritt für Schritt inhaltlich und persönlich für ihre Tätigkeitsprofile zu schulen. Berufspädagog*innen mögen Menschen und haben Freude daran, sie bei ihrer individuellen Potenzialentfaltung zu unterstützen. Dabei nutzen sie ihre didaktischen und pädagogischen Kenntnisse, um die jeweils bestmögliche Methoden und Prozesse für ein bestimmtes Lern- oder Entwicklungsziel zu finden.
Handwerkszeug in der Berufspädagogik
Berufspädagog*innen kennen zahlreiche Möglichkeiten, Wissen an andere zu vermitteln. Um die passenden Methoden zu wählen, schauen sie sich ihre jeweilige Zielgruppe, die konkreten Lernziele und das Lernumfeld ganz genau an. Bei der Auswahl geeigneter Methoden ist es für sie z.B. wichtig, vorher herauszufinden, zu welchem Lerntyp der*die Lernende gehört. Sie stellen sich Fragen wie: Sollen, wie beim Vokabellernen, ausschließlich Begriffe erlernt werden oder erfolgt ein Regellernen, wie es z.B. beim Grammatiklernen erforderlich ist? Welche Faktoren können hier ein effektives Lernen begünstigen? Wie kann das Gelernte bei der Zielgruppe längerfristig abgespeichert werden? In der Arbeitswelt können sie mit diesem Handwerkszeug ganze Fortbildungsmaßnahmen auf eine Zielgruppe zuschneiden. Dabei kennen sie Qualitätskriterien, mittels derer Sie den „Erfolg“ dieser Maßnahmen ganz konrekt bewerten können.
Berufspädagog*innen beschätigen sich aber auch mit berufspädagogischen Forschungsmethoden, um ganz neue Erkenntnisse zu erlangen. So können sie Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen, z.B. die Bildungsförderung benachteiligter Menschen oder die Digitalisierung in der Bildung, entwickeln.
Forschungsfragen
Werfen Sie einen Blick auf die Beispiele aus unserer Forschung – finden Sie diese interessant?
Interdisziplinäre und komplexer werdende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie eine zunehmende Agilität und Flexibilität in technikaffinen Arbeitsumfeldern erfordern neuartige Kooperationsformen und Lösungen zur Bewältigung der Aufgaben. Die Suche und die Verarbeitung von Daten und Informationen sowie Fragen des Wissensmanagements spielen eine immer größere Rolle. Neuartige strukturelle und technische Lösungen zur Unterstützung von Innovationsprozessen müssen entwickelt und bereitgestellt werden.
Ein Beispiel für Forschungsprojekte in diesem Bereich ist das Projekt LeWi (Lernprozessorientiertes Wissensmanagement), das im Forschungscampus der Universität Stuttgart, der ARENA2036, angesiedelt ist. LeWi ist im Rahmen des größeren Projektverbundes zur Entwicklung eines Agilen InnovationHub darauf ausgelegt, spezifische Herausforderungen eines effektiven und nachhaltigen lernprozessorientierten Wissensmanagements in einer innovationsorientierten Organisation mittels empirischer Methoden zu erforschen. Es werden Lösungsansätze hinsichtlich eines funktionalen Wissensmanagements auf dieser evidenzbasierten Grundlage angeboten, implementiert und evaluiert.
Neben der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und Schulen steht auch die Hochschulbildung im Fokus aktueller berufspädagogischer Forschungsprojekte. Dabei werden beispielsweise sowohl universitäre Lehrformate wie auch verschiedene Prüfungsformen auf ihre Wirksamkeit und etwaige Optimierungspotenziale untersucht. Das übergeordnete Ziel ist eine kompetenzorientierte Hochschullehre und Prüfungspraxis, die über die reine Vermittlung von Fachwissen hinausgeht.
Sowohl die universitäre Lehre als auch die Prüfungspraxis werden im Rahmen des Projektes QuaLIKiSS (Qualitätspakt Lehre - Individualität und Kooperation im Stuttgarter Studium) fokussiert. In einem ersten Projektteil werden praxisorientierte Module für Berufspädagogik-Studierende entwickelt und umgesetzt, die einen anwendungsnahen Zugang zu relevanten Themen erlauben, was auch die Verständlichkeit der Inhalte erhöht. In einem zweiten Projektteil werden die eingesetzten Prüfungen der Berufspädagogik, Konstruktionslehre und der Volkswirtschaftslehre wissenschaftlich analysiert und untersucht, an welcher Stelle Optimierungspotenzial besteht. Durch die Betrachtung der einzelnen Prüfungen lassen sich Aussagen zur Bedeutung des Grundlagenwissens für spätere Veranstaltungen treffen. Daran anschließend wird ein Rückmeldewerkzeug entwickelt, das für Studierende eine individualisierte Leistungsrückmeldung über die Note hinaus ermöglicht.
In Zeiten zunehmender Digitalisierung in Unternehmen und Bildungseinrichtungen kommt die Frage auf, wie digitale Lehr-Lernangebote gestaltet werden müssen, welche Besonderheiten sich im Vergleich zu Präsenzangeboten ergeben und wie die Qualität der Lehr-Lernangebote gewährleistet werden kann. Besonders im Bereich der Hochschullehre besteht dazu noch Forschungsbedarf. Gestaltungsansätze und Evaluation digitaler Lehr-Lernangebote ermöglichen dabei eine hochwertige und wissenschaftlich fundierte Digitalisierung der Lehre.
Ein praktischer Untersuchungsaspekt bezüglich der Gestaltung und Qualität digitaler Lehre ergab sich im Rahmen der Covid-19-Pandemie und der plötzlichen Umstellung der Hochschullehre auf rein digitale Fernlehre. Das Projekt Lehrqualität und Studienerfolg in der Coronakrise an der Universität Stuttgart (CorUS) untersucht, wie die Umstellung der digitalen Lehre gelingt und wie die digitalen Lehr-Lernangebote von den Lehrenden und Lernenden wahrgenommen werden, um Aussagen zur Umsetzung und Qualität digitaler Lehre an der Universität Stuttgart zu treffen. Daraus lassen sich Aussagen ableiten, wie digitale Lehre im Hochschulkontext auch zukünftig umgesetzt und weiterentwickelt werden kann.
Ähnliche Studiengänge
- Technikpädagogik – Lehramt an berufsbildenden Schulen
für alle, die sich für die Vermittlung technischer Lerninhalte interessieren