Campusführer Stuttgart-Mitte
Objekt B + C:
Kollegiengebäudekomplex KI und KII
Konzept, Planung und Realisierung
Die Infrastruktur der Technischen Hochschule in Stuttgart-Mitte wurde im Sommer 1944 infolge der Luftangriffe auf die Innenstadt von Stuttgart fast komplett zerstört. Bei Kriegsende war die materielle Basis für einen Lehr- und Forschungsbetrieb an der TH Stuttgart weitgehend vernichtet; die Universitätsgebäude, Institute, Hörsäle und Laboratorien waren ca. zu 75% zerstört, ein großer Teil der Institutsbibliotheken und Forschungseinrichtungen waren verbrannt.
Trotzdem nahm die Technische Hochschule (TH Stuttgart) mit einem Festakt am 23. Februar 1946 den Lehrbetrieb wieder auf. Der Aufbau der zerstörten Objekte war zu diesem Zeitpunkt bereits in vollem Gange. Am Standort der Universität in Stuttgart-Mitte wurde nach Abwägung einiger Varianten festgehalten. Die Zahl der Studenten übertraf alle Schätzungen, der Bedarf an Gebäuden und Räumen war sehr groß. Das vom Prof. Richard Döcker geplante �Z-Gebäude� erwies sich noch vor seiner Genehmigung als zu klein. Die entsprechenden Kapazitäten konnten nur durch ein Hochhaus auf dem vorhandenen Grundstück in der Stadtmitte gesichert werden.
Kollegiengebäude I
Die Landesregierung und die Stadt Stuttgart stimmten nach langer Überlegung dem Antrag der TH Stuttgart für den Bau eines Hochhauses - Kollegiengebäude I (K I) an der Keplerstraße 11 - zu. Mit der Planung dieses Gebäudes wurde die Architektur-Abteilung der Technischen Hochschule Stuttgart beauftragt; die Realplanung ging an die drei TH-Professoren � Rolf Gutbier, Günter Wilhelm und Curt Siegel �, die alle in gleicher Weise als Urheber dieses Werkes gelten.
Für die Ausführung dieses Auftrages wurde in Stuttgart ein neues
Architektenbüro gegründet. Unter der Leitung der Architekten Heinle und Wischer
wurde zusammen mit den TH-Professoren die Entwurfs- und die Ausführungsplanung
erstellt. Die
statischen Berechnungen und die Konstruktionsplanung wurden durch die
Ingenieurbüros Kintzing und Dr.-Ing. Schmidt-Hieber Stuttgart erstellt. Mit der
Begutachtung der Konstruktion und der Prüfstatik wurde Dr.-Ing. Kurt
Beisswenger aus Stuttgart beauftragt. Im Jahr 1954 wurde das Nutzungsprogramm
mit allen Beteiligten abgestimmt und die Planungsgrundlagen aufgestellt und
genehmigt. Die Vorentwürfe waren im Jahr 1955 fertig. Nach der Genehmigung des
Bauvorhabens durch das damalige Regierungspräsidium Nordwürttemberg wurde mit
den Bauarbeiten im November 1956 begonnen. Nach einer Bauzeit von 4 Jahren ist
das Kollegiengebäude I im Juni 1960 fertig gestellt worden. Im
Kollegiengebäude I wurden zuerst die Institute für Architektur, sowie für das
Bauingenieur- und Vermessungswesen angesiedelt; letztere wurden später in
andere Neubauten verlegt; seitdem nutzt die Fakultät für Architektur und
Stadtplanung das Objekt alleine. Kollegiengebäude II Schon während des Baus des
Kollegiengebäudes K I zeigten die neuesten Ermittlungen, dass die Zahl der
zukünftigen Studenten der Technischen Hochschule viel schneller steigen wird
als bis dahin angenommen wurde. Die vorhandene Nutzfläche des Gebäudes KI
reichte also nicht aus. Der Rektor der TH Stuttgart, Prof. Senger, sagte: � Die
Hochschule befindet sich heute auf dem Tiefpunkt ihrer Raumnot�. Hinzu kam
die Notwendigkeit, ein Haus für zusätzliche Hörsäle zu bauen, das wegen der
Problematik der Durchlüftung des Stuttgarter Talkessels, als frei stehendes
objekt nicht realisierbar war. Die Idee der Planer, an der
Keplerstraße parallel zu dem ersten Hochhaus einen �Zwillingsbau KII�
aufzustellen, fand viele Befürworter und nicht weniger Kritiker. In der
Stuttgarter Zeitung vom 21. November 1958 wurde berichtet: �In Bevölkerung und
Gemeinderat der Stadt Stuttgart hat der Plan der Staatlichen Bauverwaltung,
zwischen dem noch im Bau befindlichen Hochhaus der Technischen Hochschule und
der Kriegsbergstraße, gegenüber dem Katharinenhospital, ein zweites Hochhaus
von gleicher Größe und Höhe zu errichten, Beunruhigung und Ablehnung ausgelöst�. Trotz des Widerstandes wurde am
11. Dezember 1958 durch den Technischen Ausschuss der Stadt Stuttgart ein neuer
Bebauungsplan für den Bau des �Zwillings - Hochhauses� auf Antrag des
Oberbürgermeisters Klett genehmigt. Dazu war auch ein Grundstückstausch
zwischen der Stadt Stuttgart und der Verwaltung der TH Stuttgart notwendig.
Nach langen Überlegungen wurde die Idee des Gebäudekomplexes KI und KII mit
einem Tiefhörsaalobjekt geboren. Das Hörsaalgebäude wurde als ein tief unter
Erde gesetzter und bis zur Höhe des Stadtgartens mit Erde überschütteter
Baukörper geplant. Der Höhenunterschied zwischen der Keplerstraße und dem
Stadtgarten wurde mit dem Bau einer Außentreppe zwischen beiden Gebäuden
gelöst, von deren oberen Vorplatz die Haupteingänge zu den beiden Kollegiengebäuden
KI und KII geplant waren. Die Architektur- und die
Konstruktionsplanung des Gebäudes KII stellt eine Anpassung der Pläne des
Gebäudes KI dar und wurde von denselben Planern erstellt. Auch die Statik und
Konstruktionspläne waren eine weitgehende Wiederholung. Lediglich der
unterirdische Baukörper der Tiefenhörsäle und des Trafogebäudes waren neu
geplant worden. Die Prüfstatik wurde dem Professor Fritz Leonhardt von der TH
Stuttgart übertragen. Mit dem Bau des Kollegiengebäudes
KII wurde im Jahr 1960 begonnen und nach vier Jahren Bauzeit konnte es im Jahr
1964 zusammen mit den Tiefenhörsälen und dem Trafogebäude fertig gestellt
werden. Das Kollegiengebäude II war zuerst für die Fakultät Maschinenbau
bestimmt. Nach der späteren Verlegung dieser Fakultät nach Stuttgart-Vahingen
wurde das Kollegiengebäude KII für die Unterbringung der
Philosophisch-Historischen Fakultät und der Fakultät für das Wirtschafts- und
Sozialwesen bestimmt. Aufgrund der weiter steigenden
Zahlen von Studenten und sowie nach der Gründung von neuen Instituten innerhalb
der Technischen Hochschule Stuttgart, die im Jahr 1966 zur Universität
Stuttgart wurde, ist die Raumnot immer noch nicht bewältigt. Es wurde damals
überlegt, ob man in der Stadtmitte noch ein zusätzliches Kollegiengebäude III.
bauen sollte. Aber aufgrund der ständigen Erweiterung des Universitätsgeländes
in Stuttgart-Vaihingen musste die Debatte, ob das K III. in der Stadtmitte zu
bauen ist, immer weiter verschoben werden, bis die Idee im Jahr 1971 endgültig
fallen gelassen wurde. Baubeschreibung Die Baukörper Der Baukörper von KI und KII
beträgt im Grundriss jeweils ca. 60 x 25 m; die Häuser sind aus städtebaulichen
Gründen quer zu der Keplerstraße aufgestellt, um die Klimaverhältnisse und die
Durchlüftung des Stuttgarter Kessels nicht zu stark zu belasten. Bei der
Festlegung der Gebäudehöhen musste ein damals in Stuttgart ehernes Gesetz
berücksichtigt werden, das besagte, dass kein Objekt dieser Umgebung die Höhe des
von Paul Bonatz erstellten Bahnhofsturmes überschreiten durfte. Somit beträgt
die Höhe der beiden Gebäude ca. 50 m - vom Niveau des Stadtgartens gemessen. Nach dem
Raumprogramm sind in beiden Gebäuden vielseitige Funktion geplant; -
- für die Studenten auf der Nordseite der Häuser Hör- und Übungssäle,
sowie Bibliotheken, -
- für die Lehrstühle und Institute wurden auf der Südseite der Häuser
Räume in verschieden Größen eingerichtet. Um die
Vielseitigkeit des Nutzungsprogramms innerhalb der begrenzten Kubatur beider
Gebäude maximal gewährleisten zu können, wurde bei der Planung der
Geschosshöhen des jeweiligen Hauses mit unterschiedlichen Höhen gearbeitet. Auf der Südseite des Gebäudes
wurden Institutsräume mit 2,50 m lichter Raumhöhe, bzw. 2,90 m Geschosshöhe,
und auf der Nordseite � die Seminarräume entsprechend mit 3,80 m, bzw. 4,35 m
geplant. Dank einer raffinierten
gegenseitigen Bündelung von jeweils drei niedrigen Institutsgeschossen mit
zwei höheren Seminargeschossen zu einer Geschossgruppe � ein �Schnitt-Trick im
Verhältnis 3:2� � konnte die Nutzfläche des Gebäudes maximalisiert werden.
Aufgrund derartiger Gestaltung des Gebäudes sind 15 Obergeschosse für
Institutsräume und entsprechend gruppiert zehn obergeschosse für Hör- und
Seminarräume entstanden. Die Grundrisse Die Normalgeschosse, beginnend ab
dem 1. Obergeschoss (OG) bis zum 10. OG, wurden funktional in drei Bereiche
untergeteilt; in den Hör- und Übungsbereich auf der Nordseite von beiden
Gebäuden mit einem breiten und hohen Flur, in die Institutsräume auf der
Südseite mit einem schmalen und niedrigen Flur und in den zwischen beiden
Teilen lokalisierten Kommunikationsbereich mit Treppenhäusern, Zwischentreppen,
sowie Aufzugs- und Installationsschächten. Die Erd- und Untergeschosse
unterscheiden sich deutlich von allen übrigen Obergeschossen. Das Erdgeschoss (EG) bildet eine
große offene Eingangshalle mit dem Haupteingang, die nur durch den Aufzugskern
und die tragenden Stützen unterbrochen wird. Diese freie Fläche des
Erdgeschosses erlaubt die ungezwungene freie Bewegung der Studenten und deren
Kommunikation vom Haupteingang zu den oberen Geschossen. Außerdem dient die
Eingangshalle als Treffpunkt für Studenten und Besucher sowie als ein
großzügiger Ausstellungsraum. Die beiden Gebäuden KI und KII
unterscheiden sich wesentlich durch die Gestaltung und Nutzung der jeweiligen
Untergeschosse (UGs. Im Kollegiengebäude KI befinden
sich im 1. UG die technischen Räume des Gebäudes, sowie der Nebeneingang von
der Keplerstraße, von da eine Treppe zur Eingangshalle im Erdgeschoss führt.
Auch das 2. UG ist für die Gebäudetechnik vorgesehen. Das 1. UG des Kollegiengebäude KII dagegen, mit Eingang von der Keplerstraße und Verbindung zu den
Tiefenhörsälen, erhält den Charakter einer zweiten Haupteingangshalle.
Die Technikräume befinden sich
teilweise auch im 1. (mit dem Zugang zum unterirdischen Trafo-Objekt) und vor
allem im 2. Untergeschoss. Im Dachgeschoss sind die Maschinenräume der Aufzüge
sowie ein Teil der technischen Gebäudeausrüstung lokalisiert. Die Fassaden Die unterschiedlichen Geschosszahlen der Nord-
und Südseite von beiden Gebäuden tragen dazu bei, dass damit völlig verschieden
Fassaden entstanden sind. Die Südfassaden wurden durch die Fensterglas- und
Betonbrüstungsstreifen horizontal gegliedert. Die Erdgeschosse heben sich durch
die großen Fensterflächen von den übrigen Geschossen ab. Dagegen sind die
Fassaden an den Nordseiten, wo sich die Institutsräume mit niedrigen
Geschosshöhen befinden, eher in Form einzelner Felder gebildet. Dieser Eindruck
wird durch die einzelnen Fensterflächen, die mit Betonelementen umrahmt sind,
stark betont. Die Stirnseiten der Ost- und Westfassaden sind bis auf den
Erdgeschossbereich gleich gestaltet. Der Abschluss der dahinter liegenden
Instituts- bzw. Seminarraumreihen bilden ca. 25 m breite Betonflächen in der
Gesamthöhe aller Obergeschosse. Diese Betonfläche wurde durch gezielte
Schalungsart bewusst strukturiert. Die Flurbereiche der oberen Geschosse sind
mit Fensterflächen im Wechsel mit Betonelementen so strukturiert, damit sie in
jeweiliger Dreier-Einheit entsprechend der Geschoss- Dreiergruppe
zusammengefasst werden. Die Konstruktion Das Hochhaus besteht aus einem
Stahlbetonskelett mit Stützenachsen im Abstand von 6,40 m und Unterzügen, die
in der Längsrichtung angeordnet sind. Die Stützen sind auf einer vollflächigen
Fundamentplatte aufgestellt. Die Abmessungen dieser Fundamentplatte sind den
Bodenverhältnissen, die aus Gipskeuperschichten bestehen, angepasst worden.
Sämtliche Wände des 2. UG sind als Wandscheiben aus Stahlbeton ausgebildet.
Diese Wandscheiben mit ihrer sehr großen Steifigkeit haben die Aufgabe, die von
oben anfallenden Kräfte auf das Fundament und damit auf den Baugrund zu
übertragen und gleichmäßig zu verteilen. Die Geschossdecken sind als
Stahlbeton � Rippendecken oder Massivdecken konstruiert. Das Dach ist als
Flachdach ausgebildet. Die Windkräfte werden durch die Endscheiben in den Nord-
und Südteilen aufgenommen und über die Stahlbetonstützen zum Fundament übertragen.
Die massiven Kernbereiche mit Aufzugschächten und Treppenhausblöcken
stabilisieren das Gebäude in Längst- und Querrichtungen. Alle Betonteile sind
in Sichtbeton ausgeführt; die Oberfläche des Betons wurde gemäß dem
Gestaltungsprinzip mit verschiedenen Strukturen ausgeführt. Die Materialien Es wurden bei diesen Gebäuden
relativ wenige unterschiedliche Materialien verwendet. Alle Betonteile der
Tragkonstruktion im Inneren der Häuser sind im Sichtbeton, ohne Putz und
Anstrich, mal mit roher, mal mit strukturierter oder glatter Schalung
ausgeführt. Bei den Fassaden wurde ebenfalls strukturierter Sichtbeton
verwendet. Die nicht tragenden Wände auf den Obergeschossen wurden als
Sichtmauerwerk ausgeführt. Die architektonische Qualität
der �Zwillingshäuser� Die Architekten dieses Gebäudes -
Gutbier, Wilhelm und Siegel - standen in der Tradition der Bauhaus-Prinzipien,
die nach 1945 in der Technischen Hochschule in Stuttgart übernommen wurden.
Die Merkmale der damals modernen Architekturrichtung beschreibt Szymczyk-Eggert
als: -
�Klarheit der Baugestalt und ihre saubere Ausformung, -
Deutlich gezeigte funktionelle Zweckmäßigkeit, -
Das Offenlegen der physischen Beschaffenheit der Materialien, sie
unverhüllt, unverputzt, unverkleidet zu
zeigen, -
Sparsamkeit der Mittel, die bewusste Reduzierung auf wenig
Materialien und der Verzicht auf ausufernden Formenreichtum, -
Material und Werkgerechtigkeit, wonach die gewählten Baustoffe nach
ihrer spezifischen Eigenart am richtigen Ort eingesetzt und entsprechend ihrer natürlichen Möglichkeiten behandelt
werden.� Die Hochhäuser des geplanten
Kollegiengebäudekomplexes sind Ausdruck des architektonischen Denkens der neuen
Stuttgarter Architektenschule 1946-1970. Hier sind klare Strukturen erkennbar,
wie sie der Bauhauslehre zugrunde lagen. Die Planung der Kollegiengebäude ist
den Prinzipien der strengen Funktionalität und der Zweckmäßigkeit unterstellt.
Der Baukörper, die Grundrisse und das außergewöhnliche Konzept der
Geschossgruppierung im Verhältnis - drei niedrige Geschosse mit zwei hohen
verbunden -, zeigen eine formale und nachvollziehbare Klarheit und
Originalität. Günter Wilhelm schrieb über das Konzept dieser Häuser: � �roh sichtbarer Beton, kein Verputz und kein
Pinselstrich auf den tragenden und Raum bildenden Gerippen und Wandflächen �
ein raues und rohes Tun! � knappste Formen und Farben bei den wenigen
zusätzlichen Teilen und Elementen wie Fensterrahmen, Türrahmen usw. Gebaut für
das prüfende Auge von angehenden Bauingenieuren und Architekten �� Rolf Gutbier hat sich aber nach vielen Jahren zu seinem Werk
kritisch geäußert: � Wir haben alle gesündigt� hat er gesagt und in den
Tiefenhörsälen hat er �die Brutalität des Neuen Bauens� gesehen. Als
Folge stellte er fest, dass �die arme Menschen genötigt sind, in der
grausamen Pracht des Rohbetons Ihr Studium zuzubringen�. Literatur: -
Becker, Norbert;
Quartal, Franz (Hrsg.): Die Universität Stuttgart nach 1945. Stuttgart 2004. -
Gutbier, Rolf:
Erlebnisse � Die Stuttgarter Architektenschule 1946-1970. In: Wechselwirkungen
(1986), 38-44. -
Szymczyk-Eggert,
Elisabeth: Das Kollegiengebäude I. der Universität Stuttgart. In:
Architektenblatt Baden-Württemberg 23 (1991). S. 187-191. -
Voigt, Johannes
H.: Universität Stuttgart. Phasen ihrer Geschichte. Stuttgart 1981. -
Technische Hochschule
Stuttgart (Hrsg.): Das Hochhaus der Fakultät für Bauwesen Stuttgart. Stuttgart 1961. 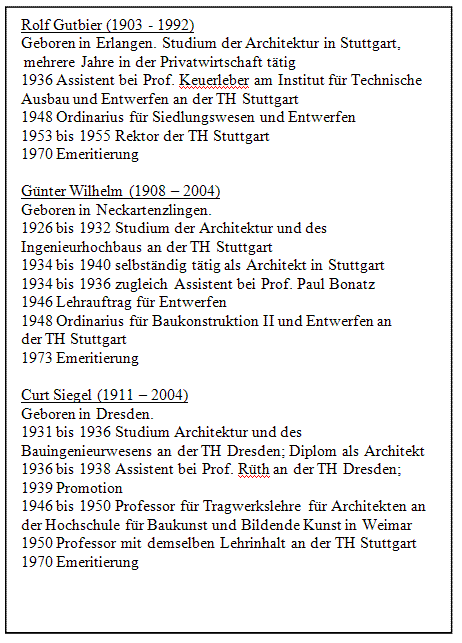
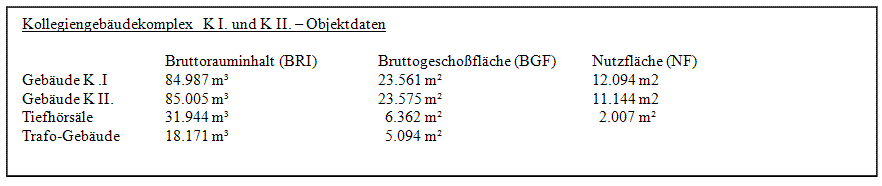
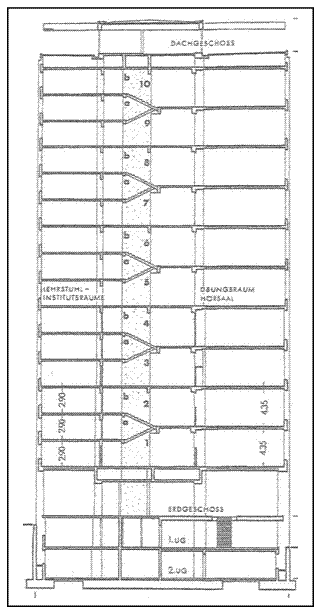 Die Haupteingänge der beiden Häuser befinden sich direkt gegenüber, auf
dem Vorplatz zwischen den Gebäuden, der von der Keplerstraße über die
Außentreppe oder von den anderen Universitätsgebäuden durch den Stadtpark zu
erreichen ist. Die Nebeneingänge zu KI und KII sind direkt an der
Keplerstraße lokalisiert und führen zum 1. UG des jeweiligen Gebäudes,
wobei der Eingang zum KII wegen der weiteren Verbindung zu den Tiefenhörsälen
die Funktion eines zweiten Haupteingangs erhalten hat.
Die Haupteingänge der beiden Häuser befinden sich direkt gegenüber, auf
dem Vorplatz zwischen den Gebäuden, der von der Keplerstraße über die
Außentreppe oder von den anderen Universitätsgebäuden durch den Stadtpark zu
erreichen ist. Die Nebeneingänge zu KI und KII sind direkt an der
Keplerstraße lokalisiert und führen zum 1. UG des jeweiligen Gebäudes,
wobei der Eingang zum KII wegen der weiteren Verbindung zu den Tiefenhörsälen
die Funktion eines zweiten Haupteingangs erhalten hat.