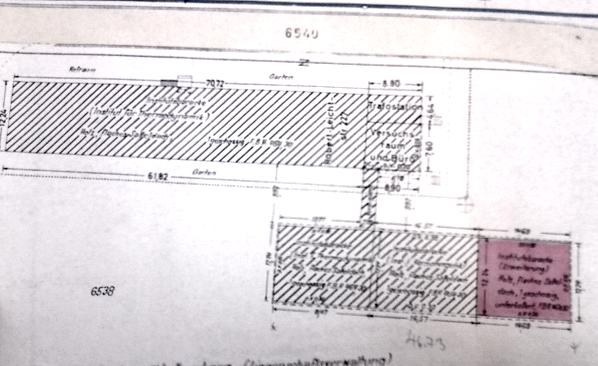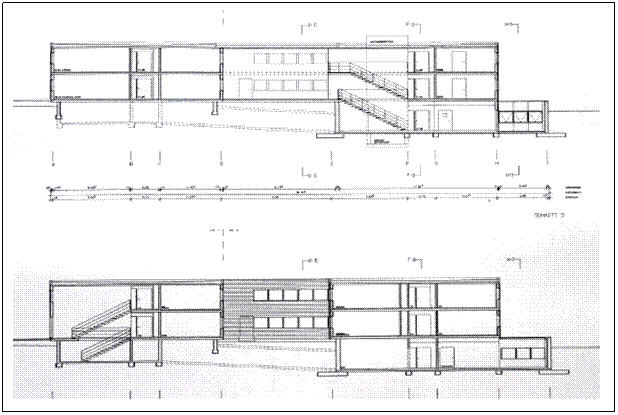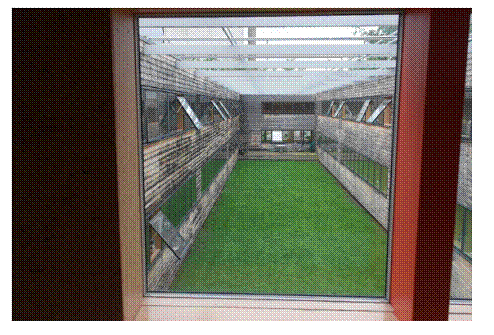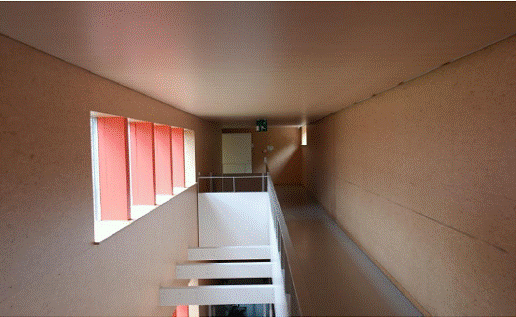Objekt O: Institut für Feuerungs- und
Kraftwerkstechnik (IFK)
Institut für Verfahrenstechnik und
Dampfkesselwesen (IVD)
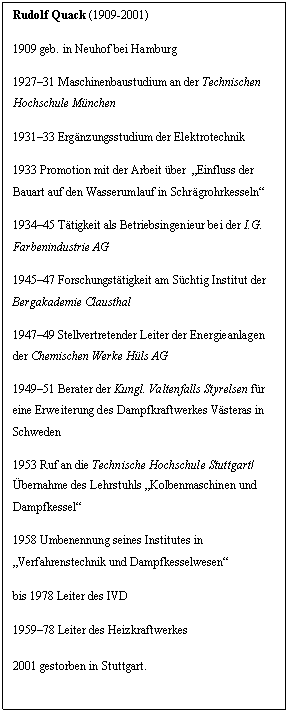 1953
folgte Rudolf Quack dem Ruf an die damalige Technische Hochschule Stuttgart.
Rudolf Quack übernahm den Lehrstuhl für „Kolbenmaschinen und Dampfkessel“ in
der Fakultät Maschinenwesen. Da man weder Räume noch Versuchsmöglichkeiten
hatte, ließ man sich in der Keplerstraße 10 nieder. Später wurde das Institut
in die Holzgartenstraße 15a verlagert.
Im Jahre 1958 entschied sich Prof. Quack für
eine Umbenennung seines Institutes in „Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen“.
Da man das Lehrgebiet „Kolbenmaschinen“ ein Jahr zuvor an Prof. Jehlicka
abgegeben hatte, empfand Prof. Quack die Umbenennung als sinnvoll. Zu diesem
Zeitpunkt engagierte sich Prof. Quack nicht nur für sein Institut, sondern war
schon an der Planung des Heizkraftwerkes in Vaihingen beteiligt, welches auf
seine Initiative hin gebaut wurde. Schon früh erkannte er die Möglichkeit, das
Heizkraftwerk nicht nur für die Energieversorgung des Universitätsbereiches
Vaihingen mit Strom und Fernwärme zu nutzen, sondern auch für die Forschung und
die Lehre. Professor Quack unterteilte das Institut in die Abteilungen
Reinhaltung der Luft, Regelungstechnik, Feuerungstechnik, Dampferzeugertechnik
sowie Stromerzeugung und Automatisierungstechnik. So schrieb Bernhard Pfau: „Er
war, wie es sich im Laufe der Entwicklung der Universität Stuttgart zeigte,
damit seiner Zeit voraus, sollte aus diesen Arbeitsgebieten mehrere neue
Institute, Studienrichtungen, Hauptfächer und sogar eine Fakultät Verfahrenstechnik
hervorgehen“.
1953
folgte Rudolf Quack dem Ruf an die damalige Technische Hochschule Stuttgart.
Rudolf Quack übernahm den Lehrstuhl für „Kolbenmaschinen und Dampfkessel“ in
der Fakultät Maschinenwesen. Da man weder Räume noch Versuchsmöglichkeiten
hatte, ließ man sich in der Keplerstraße 10 nieder. Später wurde das Institut
in die Holzgartenstraße 15a verlagert.
Im Jahre 1958 entschied sich Prof. Quack für
eine Umbenennung seines Institutes in „Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen“.
Da man das Lehrgebiet „Kolbenmaschinen“ ein Jahr zuvor an Prof. Jehlicka
abgegeben hatte, empfand Prof. Quack die Umbenennung als sinnvoll. Zu diesem
Zeitpunkt engagierte sich Prof. Quack nicht nur für sein Institut, sondern war
schon an der Planung des Heizkraftwerkes in Vaihingen beteiligt, welches auf
seine Initiative hin gebaut wurde. Schon früh erkannte er die Möglichkeit, das
Heizkraftwerk nicht nur für die Energieversorgung des Universitätsbereiches
Vaihingen mit Strom und Fernwärme zu nutzen, sondern auch für die Forschung und
die Lehre. Professor Quack unterteilte das Institut in die Abteilungen
Reinhaltung der Luft, Regelungstechnik, Feuerungstechnik, Dampferzeugertechnik
sowie Stromerzeugung und Automatisierungstechnik. So schrieb Bernhard Pfau: „Er
war, wie es sich im Laufe der Entwicklung der Universität Stuttgart zeigte,
damit seiner Zeit voraus, sollte aus diesen Arbeitsgebieten mehrere neue
Institute, Studienrichtungen, Hauptfächer und sogar eine Fakultät Verfahrenstechnik
hervorgehen“.

In den
1970er-Jahren beschäftigte das Institut 50 Mitarbeiter und verteilte sich auf
fünf Stellen (in der Keplerstraße (KII), Böblingerstraße 72 („Benger-Bau“),
Seidenstraße 50, Holzgartenstraße 15a und das HKW (im Pfaffenwaldring 8). Diese
Aufteilung des Instituts war nicht optimal und man engagierte sich für einen
Standort, der möglichst in der Nähe des Heizkraftwerks sein sollte. Es wurde
zwar ein Betriebsgebäude geplant, diese Pläne wurden jedoch zu Gunsten des
Luftfahrtgebäudes LIII verworfen. Um in der Nähe des Heizkraftwerkes zu sein
und das Institut zu vereinen, zog man 1971 in ein Holzbarackenprovisorium des
LIII ein. In der Holzbaracke befanden sich bis zu der Fertigstellung des
LIII-Gebäudes zwei Institute (Institut für Kernenergetik und
Energiesysteme und das Institut für Thermodynamik der Luft- und
Raumfahrt).
1978
wurde Prof. Richard Dolezal als Institutsleiter und zum Nachfolger von Prof.
Rudolf Quack ernannt. Unter seine Amtszeit fiel die zweite Erweiterung des
Heizkraftwerkes, die aus Umweltschutzgründen und durch ansteigenden
Energiebedarf notwendig wurde. Ferner wurde die Feuerung von schwerem Heizöl
auf Gas umgestellt. Von 1992 bis 2004 leitete Prof. Klaus R.G. Hein das
Institut und das Heizkraftwerk. Unter seiner Führung wurden weitere Versuchs–
und Technikumsanlagen zur Untersuchung feuerungstechnischer und
umweltrelevanter Fragestellungen aufgebaut. Prof. Hein konnte kurz vor seiner
Emeritierung das 2004 fertig gestellte Institutsgebäude einweihen. Seit Oktober
2004 leitet Prof. Günter Scheffknecht das Institut. Die Fortführung der
Forschungsaktivitäten und die Erweiterung der Technologien zur CO2–Abtrennung
sowie die Errichtung neuer Studiengänge ist das ausgesprochene Ziel des
Institutes. Im Jahr 2009 wurde das Institut in Institut für Feuerungs– und
Kraftwerkstechnik umbenannt und damit die Ausrichtung des Instituts weiter
präzisiert.
30
Jahre Holzbarackenprovisorium
Die Holzbaracke wurde 1961 gebaut
und diente als Zwischenlösung bis zur Fertigstellung des LIII-Gebäudes für das
neugegründete Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt (Prof.
Bosnjakovic). Die einstöckige Holzbaracke war ca. 73 m lang und ca. 13 m breit
und befand sich im nördlichen Pfaffenwald, westlich vom Heizkraftwerk. Bauherr
war das Land Baden-Württemberg und das Universitätsbauamt Stuttgart,
welches auch für die Architektur verantwortlich zeichnete. Die Baukosten
beliefen sich auf ca. 114.000 DM. 1965 wurde die Holzbaracke erweitert, indem
man eine weitere Baracke baute, die sich südlich befand und durch einen
Verbindungsgang erreichbar war. Die erweiterte Baracke war ca. 32 m lang und
war genauso breit wie die nördliche. Da sich das Institut für Kernenergetik und
Energiesysteme (Prof. Höcker) in der Zwischenzeit einquartiert hatte, benötigte
man noch mehr Platz und so wurde 1967 ein letztes Mal erweitert. So wurde die
Baracke noch um ca. 15 m verlängert. Für die komplette Erweiterung wurde
die Firma Wilh. Nusser Holzbau aus Winnenden beauftragt und eine neue
Zusatzfläche von 444 m2 erreicht. Der Kostenpunkt der Erweiterung
lag bei ca. 190.000 DM.

Abbildung 2: 1961 Fundamentierung der Holzbaracke

Abbildung 3: Fertiggestellte Holzbaracke. Im Hintergrund
sieht man die Maschinenhalle des Heizkraftwerkes.
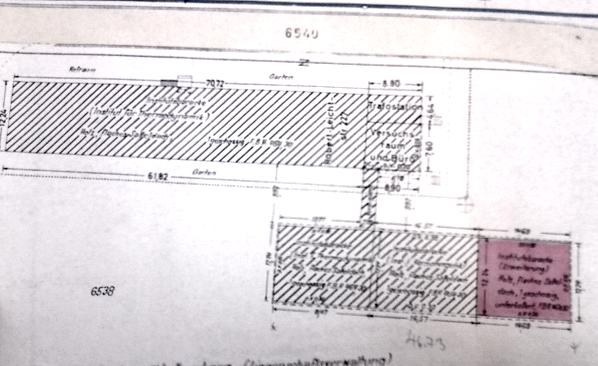
Abbildung 4: Skizze der Holzbaracke nach der Erweiterung 1967 (aus dem Archiv des Universitätsbauamts
Stuttgart)

Abbildung 5: Die Holzbaracke in den 1990er-Jahren. Im Hintergrund befindet sich das Heizkraftwerk.


Nachdem das Luftfahrtgebäude LIII 1969
fertiggestellt wurde, konnten das Institut für Thermodynamik der
Luft und Raumfahrt und das Institut für Kernenergetik ihr
neues Gebäude beziehen. Daraufhin entschloss sich das Institut für
Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen (IVD), die Räumlichkeiten der
Baracke zu nutzen und bezog sie 1971. Vor allem die Nähe zum Heizkraftwerk und
die bisherige Aufteilung des Institutes waren die Beweggründe für den Umzug
nach Vaihingen. Keiner konnte damals ahnen, dass die Baracke für die nächsten
30 Jahre das Zuhause des IVD bleiben sollte. Unzählige Anträge, Briefe, Besprechungen,
Bauplanungen sowie Besuche in der Baracke von Kanzlern, Ministern, Dekanen und
Pressevertretern hatten nichts genützt, das Holzbarackenprovisorium durch ein
adäquates Betriebsgebäude zu ersetzen. Nicht nur die räumliche Situation, die
dort beengt und unbefriedigend für Mitarbeiter und Studenten war, sondern auch
der desolate Zustand der Baracke war ein Problem für die wissenschaftliche
Arbeit. Ein poröses, undichtes Dach und unebene Böden, die wichtige
Messergebnisse zunichte machten, sind nur einige Schwierigkeiten, die man bewältigen
musste. Als Grund wurde immer wieder das fehlende Geld angegeben. Erst als man
beweisen konnte, dass das Dach Asbest-verseucht war, tat sich etwas in Richtung
Neubau. Der Leiter des Universitätsbauamtes Herr Held fand nach vielen Anläufen
und Anträgen eine Möglichkeit einen Ersatzbau, ebenfalls aus Holz, zu
finanzieren, um den für das architektonische Erscheinungsbild der Universität
in Vaihingen ungünstigen Zustand zu beenden. So wurde nach 30 Jahren
Provisorium am 22.10.1998 das gestellte Baugesuch für ein neues IVD-Gebäude
endlich vom Finanzministerium genehmigt.


Das
neue IVD-Gebäude
Die Bauarbeiten für das neue
Gebäude des Instituts für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen begannen
im Februar 1999 und das neue Gebäude konnte im August 2000 bezogen werden. Bauherr
war das Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim. Die Architektur
übernahm Frau Wehner (Universitätsbauamt). Den Bauauftrag erhielt die Firma Muny
GmbH aus Kornwestheim. Die Kosten des Ersatzbaus betrugen 2 850 000 DM. Der
Neubau (IVD 1) wurde südlich der Baracke gebaut und sollte den nördlichen Teil
der Baracke aufnehmen.

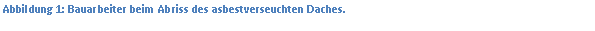
Dieser
nördliche Gebäudeteil wurde nach dem Umzug des Instituts in den Neubau abgerissen
und mit Rasen versehen. Ein Steg wurde als eine Verbindung zwischen dem Neubau
und der südlichen Baracke genutzt. Mit dem Neubau erreichte man eine Nutzfläche
von 805,22 m2, so wurden 142 m2 an Hauptnutzfläche
neugeschaffen. Die Abrissarbeiten umfassten besondere Maßnahmen, da das Dach
Asbestspuren enthielt.

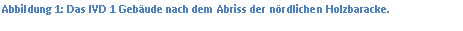
Konstruktion

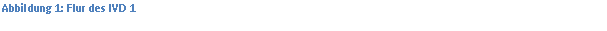
Die Baukonstruktion des
Neubaus ist eine zweigeschossige Holztafel–Fertigbauweise auf einer
Betonplatte. Die Betonplatte ist nur im Eingangsbereich des Neubaus
unterkellert. Das Untergeschoss wurde in Stahlbeton ausgeführt und dient den
technischen Installationen als Anschlussraum. Die Fundamentierung erfolgte
durch Streifenfundamente. Die restliche Betonplatte wurde als Bodenplatte auf
Streifenfundamenten in Ortbeton ausgeführt. Die Außenwände wurden aus insgesamt
10 Holztafeln von 12,10 m x 2,75 m Größe auf diese Betonplatte aufgesetzt. Die
Decke bildet eine Holzbrettstapeldecke, auf die wiederum 10 Holztafeln des
Obergeschosses als Außenwand montiert wurden. Das Dach ist eine Holzbalkenkonstruktion mit
dazwischenliegender Wärmedämmung, es wurde als Flachdach ausgeführt. Eine
Douglasien-Holzschalung bildet die Außenhaut der Außenwände. Die Fenster sind
ebenfalls aus Holz. Die Räume des Neubaus wurden längs eines innenliegenden
Flures angeordnet. Die Innenwände wurden wie die Außenwände als Holzfertigteilwände ausgekleidet und mit Wärmedämmung
ausgestattet. Die WCs sowie die Wasch– und Umkleideräume wurden mit
wasserabweisenden Bodenbelägen ausgelegt. Im Erdgeschoß befinden sich alle
publikumsintensiven Bereiche wie der Seminarraum, der Sozialraum, die Labore
sowie einige Büros. So ist das Erreichen der Seminarräume, Büros und Labore
auch für behinderte Studenten und Mitarbeiter sichergestellt.
Das IVD 2
Um für die andere Hälfte
der IVD-Mitarbeiter einen angemessenen Arbeitsplatz zu schaffen, wurde das IVD
2-Gebäude gebaut. Der Ersatzbau 2 sollte die zweite baufällige Baracke ersetzen
und dem IVD auch nach außen ein Erscheinungsbild verleihen, das dem hohen
Niveau der dort praktizierten Forschung entspricht. Den Zuschlag für den Rohbau
des Projektes IVD 2 bekam die Firma Gottlob Stäbler GmbH + Co. KG aus
Weil der Stadt, die Firma Merkle GmbH aus Bissingen/Teck übernahm den
Holzbau. Die Bauarbeiten gingen von Juli 2002 bis März 2004. Die Baukosten
beliefen sich auf 4.990.000 DM, wobei man eine Hauptnutzfläche von 1169 m2
erreichte. Das Baugrundstück für die Institutserweiterung liegt im Norden der
Universität Stuttgart–Vaihingen zwischen Heizkraftwerk und Luftfahrt 2, direkt
südlich des IVD 1.

Abbildung
11: Das Institutsgebäude heute
Konstruktion
Der Baukörper des Ersatzbaus IVD 2 ist, um ein einheitliches
Erscheinungsbild des IVD zu bewahren eine weitgehende Replik des
zweigeschossigen Ersatzbaus IVD 1. Der Bau wurde vom Architekten des
Universitätsbauamtes Herrn Vielhauer betreut. Konstruktion, Bauwerksgeometrie
sowie Geschosshöhe wurden übernommen. Die Anbindung des zweiten an den ersten
Bauabschnitt wurde durch im Osten und Westen gelegene Verbindungen realisiert,
in der sich auch die Treppen befinden. Die technische Versorgung erfolgt durch
Anbindung an die Technikzentrale des IVD 1. Die beiden Baukörper umschließen
einen ca. 8 m breiten und 41 m langen Innenhof und werden durch einen
unterirdischen Gang miteinander verbunden. Von August 2008 bis Juli 2009 wurde
ein außenliegender Sonnenschutz angebaut, welcher sich vollautomatisch als auch
manuell bedienen lässt. Die Anlage soll bei hohen Außentemperaturen für
Abkühlung durch Beschattung sorgen. Architektonisch gesehen stellt der Holzbau
einerseits den Bezug zu der ursprünglichen Holzbaracke dar, anderseits verkörpert
er modernes, technisches, ökonomisches sowie ökologisches Bauen und soll eine
Identifizierung des Instituts darstellen.
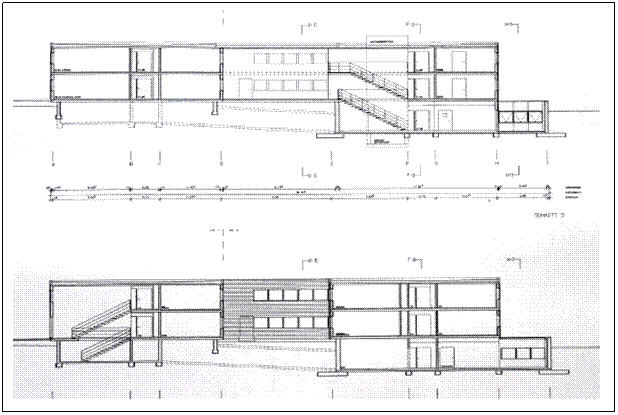
Abbildung 12: Westliche
Ansicht des Institutsgebäudes (Archiv des Universitätsbauamtes Stuttgart und
Hohenheim)
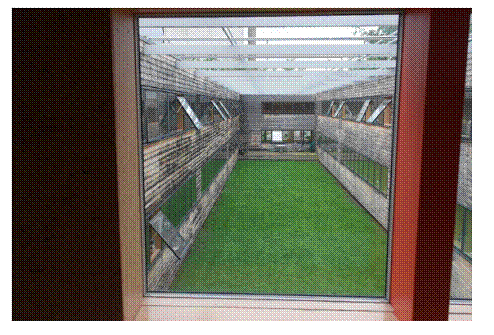
Abbildung 13: Innenhof
des Instituts
Internet-Seiten:
http://www.ifk.uni-stuttgart.de/institut/entwicklung.html
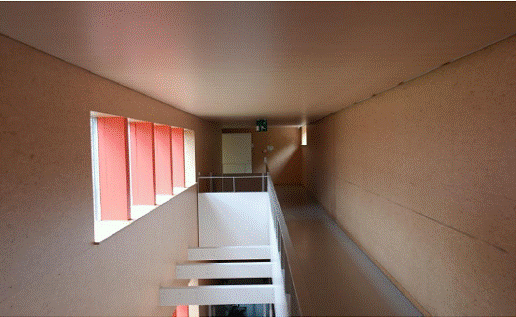
Abbildung 14: Verbindungsbereich
von IVD 1 und IVD 2

Abbildung 15: Entwurf
des Technikumsgebäudes mit Lagerhalle (gegenwärtig im Bau). Foto: Wolfram Janzer.
Danksagung:
Beim IFK standen mir apl. Prof. PD Dr.-Ing. Uwe Schnell
und der ehemalige Mitarbeiter des Instituts Bernhard Pfau zur Seite und haben
mir sehr interessiert Fragen beantwortet. Mit Prof. Uwe Schnell habe ich eine Begehung des Instituts machen dürfen. Alle Vorgenannten
stellten mir auch einige Fotos zur Verfügung.
Literatur:
Pfau, Bernhard: Ein interdisziplinärer
Hochschullehrer in Stuttgart – Rudolf Quack, in: Die Universität Stuttgart
nach 1945, hrsg. v. Nobert Becker und Franz Quarthal, Stuttgart 2004, S.
269
Quellen:
Universitätsarchiv Stuttgart Stadtmitte
Archiv des Universitätsbauamtes Stuttgart
und Hohenheim in Vaihingen
Photographie von Wolfram Janzer (Abb.15)
Photographien des Autors aus dem Jahr 2012
Autor:
Amer
Kalender, BA-Student der GNT
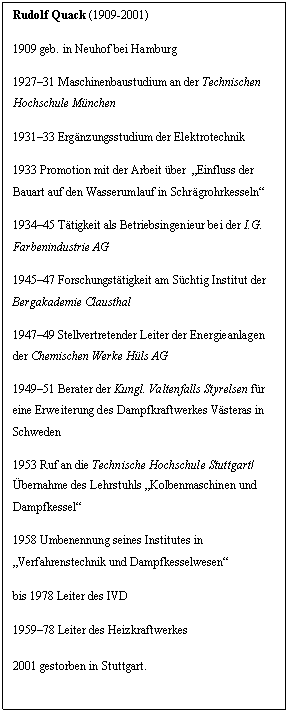 1953
folgte Rudolf Quack dem Ruf an die damalige Technische Hochschule Stuttgart.
Rudolf Quack übernahm den Lehrstuhl für „Kolbenmaschinen und Dampfkessel“ in
der Fakultät Maschinenwesen. Da man weder Räume noch Versuchsmöglichkeiten
hatte, ließ man sich in der Keplerstraße 10 nieder. Später wurde das Institut
in die Holzgartenstraße 15a verlagert.
Im Jahre 1958 entschied sich Prof. Quack für
eine Umbenennung seines Institutes in „Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen“.
Da man das Lehrgebiet „Kolbenmaschinen“ ein Jahr zuvor an Prof. Jehlicka
abgegeben hatte, empfand Prof. Quack die Umbenennung als sinnvoll. Zu diesem
Zeitpunkt engagierte sich Prof. Quack nicht nur für sein Institut, sondern war
schon an der Planung des Heizkraftwerkes in Vaihingen beteiligt, welches auf
seine Initiative hin gebaut wurde. Schon früh erkannte er die Möglichkeit, das
Heizkraftwerk nicht nur für die Energieversorgung des Universitätsbereiches
Vaihingen mit Strom und Fernwärme zu nutzen, sondern auch für die Forschung und
die Lehre. Professor Quack unterteilte das Institut in die Abteilungen
Reinhaltung der Luft, Regelungstechnik, Feuerungstechnik, Dampferzeugertechnik
sowie Stromerzeugung und Automatisierungstechnik. So schrieb Bernhard Pfau: „Er
war, wie es sich im Laufe der Entwicklung der Universität Stuttgart zeigte,
damit seiner Zeit voraus, sollte aus diesen Arbeitsgebieten mehrere neue
Institute, Studienrichtungen, Hauptfächer und sogar eine Fakultät Verfahrenstechnik
hervorgehen“.[1]
1953
folgte Rudolf Quack dem Ruf an die damalige Technische Hochschule Stuttgart.
Rudolf Quack übernahm den Lehrstuhl für „Kolbenmaschinen und Dampfkessel“ in
der Fakultät Maschinenwesen. Da man weder Räume noch Versuchsmöglichkeiten
hatte, ließ man sich in der Keplerstraße 10 nieder. Später wurde das Institut
in die Holzgartenstraße 15a verlagert.
Im Jahre 1958 entschied sich Prof. Quack für
eine Umbenennung seines Institutes in „Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen“.
Da man das Lehrgebiet „Kolbenmaschinen“ ein Jahr zuvor an Prof. Jehlicka
abgegeben hatte, empfand Prof. Quack die Umbenennung als sinnvoll. Zu diesem
Zeitpunkt engagierte sich Prof. Quack nicht nur für sein Institut, sondern war
schon an der Planung des Heizkraftwerkes in Vaihingen beteiligt, welches auf
seine Initiative hin gebaut wurde. Schon früh erkannte er die Möglichkeit, das
Heizkraftwerk nicht nur für die Energieversorgung des Universitätsbereiches
Vaihingen mit Strom und Fernwärme zu nutzen, sondern auch für die Forschung und
die Lehre. Professor Quack unterteilte das Institut in die Abteilungen
Reinhaltung der Luft, Regelungstechnik, Feuerungstechnik, Dampferzeugertechnik
sowie Stromerzeugung und Automatisierungstechnik. So schrieb Bernhard Pfau: „Er
war, wie es sich im Laufe der Entwicklung der Universität Stuttgart zeigte,
damit seiner Zeit voraus, sollte aus diesen Arbeitsgebieten mehrere neue
Institute, Studienrichtungen, Hauptfächer und sogar eine Fakultät Verfahrenstechnik
hervorgehen“.[1]